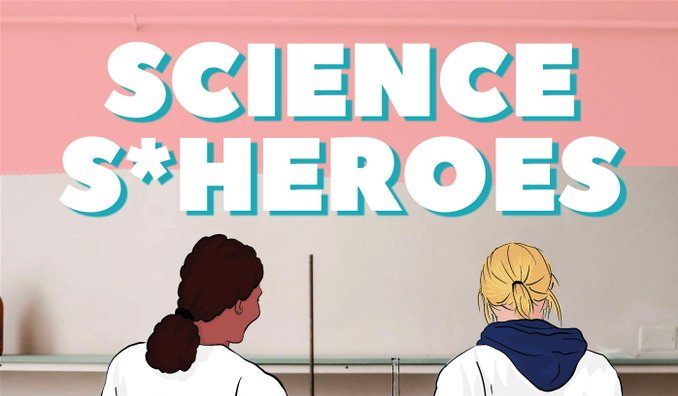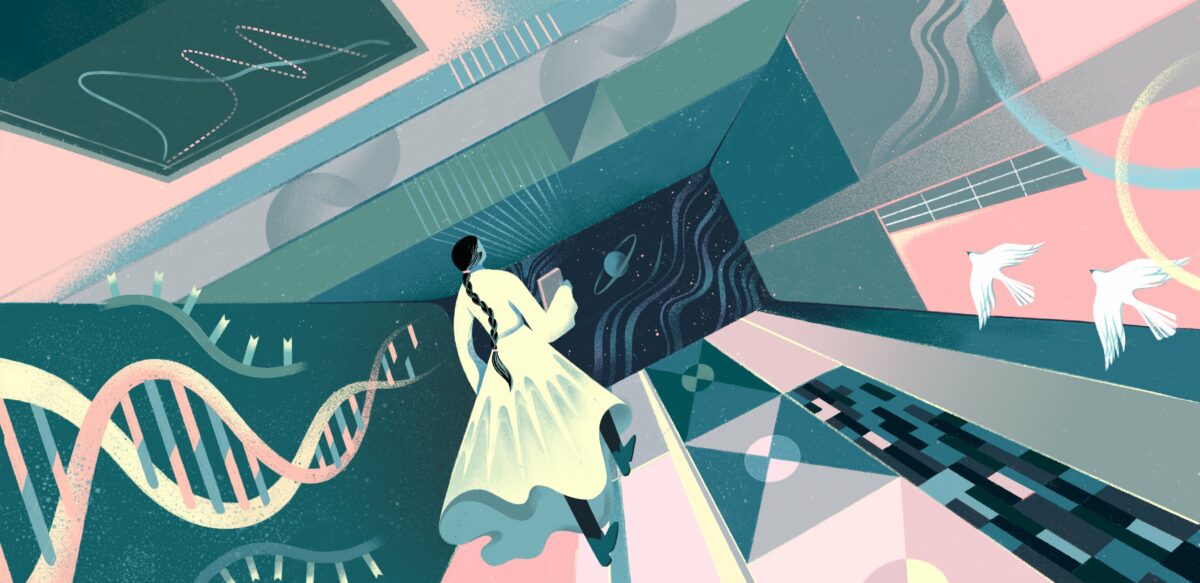Ob Strömungstheorie, Stereotype in der Ingenieursgeschichte oder Videospielmusik – in allen drei Feldern arbeiten Forscher*innen daran, unser Wissen und Verständnis zu erweitern. Seit dem vergangenen Sommer gibt es mit „Science S*heroes“ einen Podcast, in dem sie zu Wort kommen.