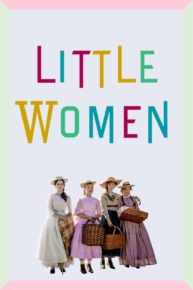„Und… wen heiratet sie am Schluss?“, wird die junge Schriftstellerin Jo March in Greta Gerwigs neuem Film „Little Women“ von ihrem Verleger gefragt. Die Art, wie diese Frage beantwortet wird, ist einer der brillantesten Einfälle von Gerwigs Adaption des gleichnamigen zweiteiligen Romans von Louisa May Alcott.
„Little Women“ erzählt von den vier Schwestern Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) und Amy March (Florence Pugh), die während des amerikanischen Bürgerkriegs im Nordosten der Vereinigten Staaten aufwachsen. Hauptfigur Jo will Autorin werden und ein eigenständiges Leben führen. Alle Schwestern haben Träume und Ambitionen bezüglich Kunst und Liebe, aber das patriarchale System kennt keine Gnade. Frauen, die kein Geld haben, müssen in erster Linie reich heiraten, wie ihre Großtante March (Meryl Streep) erklärt.

Der Film dreht sich zunächst vor allem um das Familienleben der Marches, wie sie in die Schule und auf den Ball gehen und sich mit dem Nachbarsjungen Laurie anfreunden (Timothée Chalamet), der bei seinem Großvater aufwächst. Allmählich entfalten und verdichten sich die Schicksale der jungen Frauen, und als sie erwachsen werden, erhöhen sich auch die Konsequenzen ihrer Entscheidungen.
Gerwigs Adaption erzählt nicht chronologisch, sondern bricht die Geschichte in Parallelen und Rückblenden auf. So lernen wir die Schwestern nach und nach besser kennen und können in den alltäglichen Szenen – ob beim Streiten oder Theaterspielen – sowohl ihre starke Zusammengehörigkeit als auch Eifersucht, Stolz und Verletzung erkennen. Obwohl jede Schwester ihre eigene Rolle hat, werden die Figuren so als mehrdimensionale Charaktere greifbar. Das ist nicht zuletzt den großartigen Leistungen der Cast, allen voran Ronan („Ladybird“) und Pugh („Midsommar“) zu verdanken.

Die Kindheit unserer Heldinnen endet drastisch. Jo muss lernen, dass sie ihre Schwestern nicht vor allem beschützen kann. Amy trägt die Verantwortung, durch eine reiche Heirat die Familie zu versorgen. Meg, immer die Vernünftige, gründet eine eigene Familie, muss aber lernen, mit ihr in Armut zu leben. Und Beth blickt nach einer Scharlachansteckung dem Tod selbst ins Auge. Für jede Schwester gilt es, äußere Zwänge gegen eigene Wünsche und Träume abzuwägen. Dabei gelingt es dem Film besonders gut, die Momente herauszustellen, an denen sich die Figuren verletzlich zeigen und an ihren Herausforderungen wachsen.

Die größte Glanzleistung des Films ist aber die Art, wie er das Motiv der Heirat aus ökonomischen Zwängen nicht nur durch Dialoge beschreibt, sondern selbst darstellt. Gerwig schafft es durch einen erzählerischen Kniff, sowohl dem Ende der Romanvorlage treu zu bleiben als auch eine weitere Ebene hervorzuholen, die bei Alcott höchstens zwischen den Zeilen lesbar war. So öffnet sie einen Raum für eigenständige und queere Lesarten. Das gibt der Verfilmung einen modernen und zugleich zeitlosen Klang, der noch lange nach dem Verlassen des Kinos nachhallt.